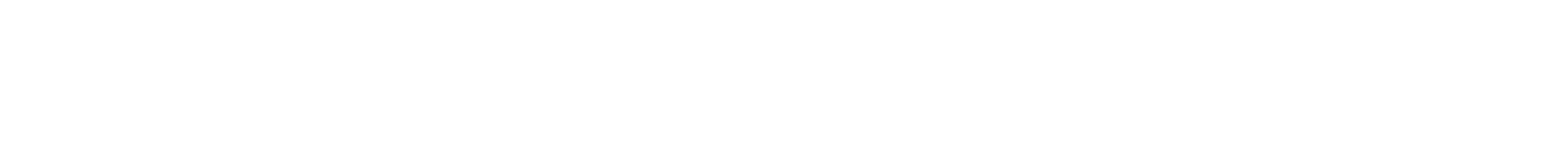Weil der Luftraum gesperrt und die Häfen gesprengt sind, ist die Ukraine im Krieg auf die Bahn angewiesen. Bahnchef Olexandr Kamischin spricht über die grosse Zerstörung – und mögliche Hilfe aus der
Schweiz.
Veröffentlicht in: Tagesanzeiger, 12. Juni 2022

Olexandr Kamischin steht auf dem Bahndamm oberhalb des Flusses Irpin und blickt die Gleise entlang, die von hier in die ukrainische Hauptstadt Kiew führen. «Experten sagten uns, der Wiederaufbau einer zerstörten Brücke sei eine Frage von Monaten», sagt Kamischin und zeigt mit sichtbarem Stolz auf einen provisorischen Brückenpfeiler aus Stahlrohren: «Wir haben es in 30 Tagen geschafft!» Dann steigt er über Schutthalden hinunter zum Flussufer, gibt den Bahnarbeitern ein paar Anweisungen, klopft dem Vorarbeiter auf die Schultern: «Er hier ist der wahre Held.»
Der erst 38-jährige Kamischin ist seit einem knappen Jahr Vorstandsvorsitzender des grössten staatlichen Betriebs in der Ukraine, der Staatsbahn Ukrsalisnizja. An diesem heissen Junitag ist er mit einem Extrazug aus dem dreissig Kilometer entfernten Kiew hierhergekommen, in den Vorort Irpin. Im Dieseltriebwagen, der vor dem Krieg zwischen dem Kiewer Hauptbahnhof und dem Flughafen pendelte, ist ausser Kamischins zehn engsten Mitarbeitern auch der Journalist von Tamedia mitgefahren.
Der Name Irpin steht neben Butscha für die schlimmsten Gräueltaten der russischen Armee. Diese nahm den nördlichen Teil der Kleinstadt Anfang März ein, zerstörte die Wohnhäuser und massakrierte die Zivilbevölkerung. Um den russischen Vormarsch auf Kiew zu stoppen, sprengte die ukrainische Armee die Eisenbahn- und Strassenbrücken über den gleichnamigen Fluss. Anfang April zogen die Russen aus Irpin ab und hinterliessen eine Stätte des Grauens.
Während die Toten der Stadt mittlerweile bestattet sind, werden die Zerstörungen von Gebäuden und Infrastruktur noch lange zu sehen sein. Die Bahnstrecke über den Fluss ist nur noch auf einem statt auf zwei Gleisen befahrbar. Die zweite Brücke liegt bizarr geknickt im Schlamm. Bahnarbeiter graben die Metallstreben aus und haben dabei im Fundament den Zugang zu einem Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Den sieht sich Bahnchef Kamischin nun persönlich an. Die zweite Brücke, sagt er, werde man wohl nicht so schnell reparieren. Es gebe andere Prioritäten.
Was ist zurzeit Ihr grösstes Problem?
Die russischen Raketenangriffe. Viele Schäden können wir schnell beheben, aber nicht alle. Durch die Bombardierungen haben wir 161 Mitarbeiter verloren, 252 weitere sind verletzt. Trotzdem müssen die Züge weiterfahren: Wir transportieren immer noch täglich 30’000 Passagiere und 300’000 Tonnen an Gütern. Seit Beginn des Krieges haben wir 100’000 Tonnen an humanitärer Hilfe im ganzen Land verteilt.
Vor kurzem haben die Russen eine Eisenbahnwerkstatt in Kiew mit Raketen zerstört. Warum gerade dieses Ziel?
Die Russen beschiessen unsere Bahnanlagen ständig. Wir machen das aber nur dann öffentlich, wenn wir Verspätungen von Personenzügen erklären müssen. Oder wenn Moskau lügt. In diesem Fall behaupteten die Russen, sie hätten ein Depot mit aus Nachbarstaaten gelieferten Panzern zerstört. Deshalb zeigte ich der Presse: In dieser Werkstatt waren niemals Panzer.
Die Bahnanlagen in der Ukraine sind also viel stärker von Angriffen betroffen als bekannt?
Ja, die Russen greifen uns oft mehrmals am Tag an. Nach der Zerstörung der Kiewer Werkstatt haben sie gleich am nächsten Tag eine weitere Werkstatt beschossen, in einer anderen Region.
Können Sie den Betrieb trotzdem aufrechterhalten?
Wir fahren nach Fahrplan – allerdings deutlich langsamer. Wir haben das Tempo auf allen Strecken reduziert, damit wir im Falle von Sabotage weniger Opfer haben.
Saboteure haben Bahnanlagen angegriffen?
Es gab Versuche. Wir konnten sie abwehren.

Olexandr Kamischin ist kein gelernter Bähnler. Der gross gewachsene Mann mit markantem Kinnbart und kurzem Zopf kommt aus der Investmentbranche. Im August 2021 übernahm er die Staatsbahn mit ihren 260’000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie 150 Millionen Passagieren pro Jahr. Ähnlich wie Staatspräsident Wolodimir Selenski brachte auch Kamischin ein junges Team mit, um die veralteten Strukturen aufzubrechen und Ukrsalisnizja radikal zu modernisieren. Doch als am 24. Februar die ersten russischen Bomben fielen, musste Kamischin innert kürzester Zeit auf Kriegsmanagement umstellen.
Dass die Russen Führungskräfte wie den Bahnchef suchten und gezielt ausschalten wollten, war bekannt. Also setzte sich Kamischin in Bewegung, von Kiew nach Charkiw, von Mariupol nach Odessa, von einem Krisenherd zum nächsten. Zusammen mit einer kleinen Gruppe von jungen Managern und altgedienten Bähnlern fuhr er in den ersten Kriegstagen das Netz der ukrainischen Bahn ab. Zeitweise benutzten sie die Automatrisa – einen modernen polnischen Dieseltriebwagen, umgebaut als fahrende Kommandozentrale der Bahn. Geschlafen hat die Gruppe jeweils auf Bahnhöfen oder im Zug. Um die Gefahr eines Angriffs zu minimieren, blieben sie nie lange an einem Ort.
Welcher Moment war für Sie der schwierigste in den ersten Kriegstagen?
Der Morgen des 24. Februar, als wir die ersten Meldungen von unseren Mitarbeitern aus den Regionen bekamen: Wo die russischen Truppen vorrücken, wo die Panzer gerade kommen. Wir mussten uns erst einmal einen Überblick verschaffen.
Deshalb verlegten Sie Ihr Büro in den Zug?
Ich wusste nur, dass wir den Betrieb um jeden Preis aufrechterhalten mussten. Deshalb wollte ich nahe an den Brennpunkten sein, im Osten und im Süden.
Fuhren Sie immer in Ihrer Automatrisa?
Den Extrazug mit Büro hatten wir nur in der Westukraine. Sonst fuhren wir in Schlafwagen, im Intercity, in Regionalzügen. Die Sicherheit war immer Thema Nummer eins.
Die Russen haben Sie offenbar gesucht. Gab es gezielte Attacken auf Sie?
Sie kamen uns mehrmals sehr, sehr nahe. Einmal spürten wir die Druckwelle eines Einschlags. Dennoch glaube ich nicht, dass sie es konkret auf mich abgesehen hatten. Die Russen bombardieren alle – Eisenbahner, Lehrerinnen, Ärzte. Sie gehen nicht gezielt vor.

Von der reparierten Brücke über den Fluss fahren Kamischin und sein Team an diesem Junitag zum Bahnhof der gleichnamigen Stadt. Das Zentrum von Irpin wirkt in diesen Tagen, als hätte es nie Krieg gegeben. Viele Geschäfte sind wieder geöffnet, die Parks belebt. Doch nur hundert Meter weiter beginnt die Todeszone der mehrwöchigen russischen Besetzung. Wohnhäuser, Fabriken, das Kulturzentrum – alles in Trümmern. In den Wohnhäusern, die noch stehen, gibt es keine einzige heile Fensterscheibe mehr.
Weil viele Geflüchtete dennoch nach Irpin zurückkehren, hat Olexandr Kamischin beim Bahnhof sechs Schlafwagen als provisorische Unterkünfte aufstellen lassen. Bevor in den kommenden Tagen bis zu einhundert Menschen einziehen, lässt er sich die sanitären Anlagen und den Versorgungsplan im Speisewagen erklären. In den Nachbarstädten wie Butscha werden für die Rückkehrer Containersiedlungen gebaut.
Für Irpin ist die Bahn jetzt wichtiger denn je: Die meisten Menschen arbeiten in der Hauptstadt. Mit dem Auto zu pendeln, ist für sie wegen der extrem hohen Benzinpreise fast unmöglich geworden. Vor den wenigen Tankstellen, die noch Treibstoff verkaufen, muss man zudem stundenlang warten.
Die Bahn ist da eine preiswerte Alternative. Die meisten Züge stammen allerdings aus Sowjetzeiten. In Kiew haben die Russen zwar weniger zerstört als in den Ballungsräumen Charkiw oder Mariupol. Dennoch bräuchte die Bahn auch hier dringend Ersatzteile und – vor allem – neue Züge.
Für die vielen Rückkehrer wird es immer schwieriger, kurzfristig Tickets zu bekommen. Die wenigen Intercitys und Nachtzüge, die aus Ungarn und Polen in die ukrainischen Städte fahren, sind auf Wochen hinaus ausgebucht. Auf dem veralteten Schienennetz müssen zudem viel mehr Güterzüge als zu Friedenszeiten geführt werden. Weil ukrainisches Getreide nicht mehr über die von den Russen gesperrten oder zerstörten Häfen exportiert werden kann, drohen laut UNO Hungersnöte in Afrika.
Kann die Bahn einspringen, wenn der Transport auf Schiffen nicht mehr möglich ist?
Vor dem Krieg konnte die Ukraine 7 Millionen Tonnen Getreide pro Monat ausführen, hauptsächlich über Seehäfen. Wir befördern derzeit auf der Schiene 1,2 Millionen Tonnen pro Monat. Mehr wäre nur durch bessere Kooperationen mit den Nachbarstaaten möglich. Wir haben Waggons für den Getreidetransport auf der europäischen Normalspur gebaut und warten auf deren Zulassung in Polen. Damit könnten wir zu den Häfen in Danzig und Gdynia fahren.
Sie bekommen die polnische Zulassung nicht?
Sie wird kommen, aber die europäischen Länder sind halt nicht im Krieg und arbeiten in anderer Geschwindigkeit. Wir aber müssen schnell sein. Wenn wir nicht rennen, sind wir tot. Vor diesem Problem stehen die europäischen Staaten nicht.

Kann die Schweiz helfen?
Zerstörte Schienenverbindungen stellen wir innert Stunden oder Tagen selbst wieder her. Die volle Restaurierung unseres Netzes wird jedoch sehr teuer. Die Schweizer Firma Stadler Rail hat etwas, das wir nach dem Krieg dringend benötigen werden: gutes Rollmaterial.
Haben Sie mit Stadler Kontakt aufgenommen?
Nein, denn ich verstehe die Positionierung von Stadler nicht. Sie haben eine Fabrik in Belarus, sie haben geschäftliche Interessen in Russland. Beides versuchen sie zu retten, ohne Gesichtsverlust.
Soll sich die Firma aus Belarus zurückziehen?
Andere internationale Unternehmen haben das schon gemacht. Nicht nur wegen des Krieges, sondern weil sie dort keine wirtschaftliche Zukunft sehen. Wir sind jetzt im Krieg und brauchen vor allem Waffen. Aber wir sind auch ein hoch industrialisiertes Land und haben viel zu transportieren, neben Getreide auch Holz und Eisenerz. Wer mit uns Geschäfte macht, kann gut verdienen.
Wäre nach dem Krieg eine Fabrik von Stadler in der Ukraine denkbar?
Das hängt von Stadlers politischer Positionierung ab. Ausserdem sagen wir hier: Wer in Kriegszeiten hilft, der hilft doppelt. Für jene, die nach dem Krieg kommen, wird es anders aussehen.
Kurz vor 20 Uhr kommt der Extrazug mit dem Bahnchef wieder in Kiew an. Olexandr Kamischin verschwindet mit seinen Mitarbeitern sofort zu einer weiteren Besprechung in der eleganten Businesslounge des Hauptbahnhofs. Auch als er noch in der Investmentbranche gearbeitet habe, sei er immer mit dem Zug gefahren, sagt Kamischin zum Abschied: «Die Nachtzüge sind ideal für die grossen Distanzen zwischen den ukrainischen Städten. Und nach dem Krieg machen wir die Bahn noch viel besser.»