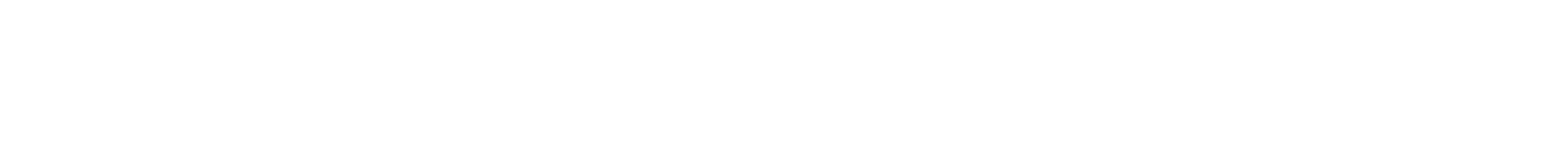Der Schweizer Nationalrat diskutiert die Einsetzung einer Taskforce zum Aufspüren von versteckten russischen Vermögen. Ein Luxushotel im Engadin zeigt, warum das so schwierig ist.
Veröffentlicht in: Tagesanzeiger, 13. Dezember 2022

«Einzigartige Angebote. Neue Massstäbe. Eine Legende.» Auf der Homepage des Hotels Grace La Margna wird nicht mit Superlativen gespart. Dabei ist das Jugendstilhaus gleich hinter dem Bahnhof von St. Moritz noch immer eine Baustelle: Der massive Anbau ist unter einem Gerüst versteckt, durch ein Fenster im Altbau kann man Baumaterial, Gipskartonplatten und herunterhängende Leitungen sehen.
Ursprünglich wurde die Wiedereröffnung als «luxuriöses Boutiquehotel mit urbanem Touch» für Dezember 2022 angekündigt. Nun heisst es: Februar 2023. Doch bei Temperaturen weit unter null Grad sind derzeit höchstens Innenarbeiten möglich. Wann also werden die ersten Gäste empfangen? Vor dem Eingang steht ein Arbeiter, der auf die Frage den Kopf schüttelt und mit starkem slawischen Akzent antwortet: «Noch lange nicht.»
Der Investor bleibt namenlos
Noch rätselhafter als der Eröffnungstermin sind die Besitzverhältnisse des Hotels. Als vor mehr als einem Jahr erste Berichte über die Auferstehung der historischen Herberge in neuem Gewand erschienen, war von zwei Russen die Rede: Alexander Matytsyn und Pavel Zhdanov. Beide arbeiten in der Führungsetage des russischen Ölkonzerns Lukoil. Beide werden in Medienmeldungen auch als Eigentümer des Grand Hotel Kempinski in St. Moritz genannt, Zhdanov ist als Verwaltungsrat der Betreiberfirma eingetragen. War den Russen ein Hotel nicht genug? Kauften sie dazu auch noch das La Margna?
In letzter Zeit sind in mehreren Tourismus-Medien sowie in der «SonntagsZeitung» Vorankündigungen zur Wiederbelebung des Hotels erschienen. Von russischen Besitzern ist da keine Rede mehr. Nun heisst es, ein Investor aus der Europäischen Union stehe hinter der Renovierung, einmal ist auch von einem Mann aus Irland die Rede. Wer der geheimnisvolle Eigentümer ist, will auch Hotel-Geschäftsführer David Frei nicht verraten. Denn: «Der Investor will nicht öffentlichwirksam erwähnt werden». Gehört der Luxustempel also vielleicht doch noch den Russen aus dem Umfeld von Lukoil? Von Frei kommt keine Antwort.
Der Fall des Hotels führt in den Kern einer aktuell viel diskutierten Frage: Wie viel russisches Vermögen lagert in der Schweiz? Gehört es Personen, die wegen des Angriffs auf die Ukraine sanktioniert sind oder noch sanktioniert werden könnten? Und wenn ja, wie können Immobilien und Bankkonten gefunden und beschlagnahmt werden?
Am Mittwoch wird sich der Nationalrat mit einer Motion befassen, welche die Einsetzung einer Taskforce verlangt, um genau solche Fragen zu klären. Die Kommission für Wirtschaft und Abgaben hat der Motion mit knapper Mehrheit zugestimmt. Der Bundesrat lehnt sie ab.
Bisher wurden laut dem Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) 7,5 Milliarden Franken und 15 Liegenschaften gesperrt, die sanktionierten Russen gehören. Insgesamt wurden dem Seco russische Konten in der Höhe von 46 Milliarden Franken gemeldet, wobei russische Aktiendepots dabei nicht berücksichtig wurden. Die Bankiervereinigung schätzt die russischen Vermögen in der Schweiz total auf bis zu 200 Milliarden Franken.
Doch bei Immobilien sind die Besitzverhältnisse mitunter nicht so einfach zu klären wie bei Konten oder Aktiendepots. Wie schwer das sein kann, zeigt eben das Hotel Grace La Magna im Engadin. Sollte das Hotel tatsächlich russische Besitzer haben, dann müsste man abklären, ob sie auf den Sanktionslisten stehen.
Beide arbeiten in der Lukoil-Konzernleitung
Pavel Zhdanov und Alexander Matytsyn, die beiden Russen, die 2021 in der «Handelszeitung» genannt werden, arbeiten in der Konzernleitung von Lukoil. Matysyn war zumindest bis zum Sommer 2022 auch Aktionär. Lukoil ist einer der grössten Ölförderkonzerne der Welt und eine der wichtigsten wirtschaftlichen Stützen des Regimes von Wladimir Putin. Jahrzehntelang lenkte der Oligarch Wagit Alekperow das Unternehmen, als Hauptaktionär, CEO und später Präsident des Verwaltungsrates. Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine kam Alekperow auf die Sanktionsliste Grossbritanniens und zog sich kurz darauf offiziell aus dem Unternehmen zurück. Lukoil selbst ist seit 2014 in den USA sanktioniert, die Schweizer Tochterfirma ist jedoch davon ausgenommen. In Europa treffen den Konzern nun Boykott und Preisdeckel für Ölimporte aus Russland.

Zhdanov ist bei Lukoil Vizepräsident Finanzen, der 61-jährige Matytsyn ist Vizepräsident des gesamten Konzerns. Beide Manager sind von den Sanktionen zwar nicht persönlich betroffen. Doch ihre Arbeit an der Spitze eines Konzerns unter US-Sanktionen birgt Risiken für das Hotel. Heute tauchen ihre Namen rund um das La Margna nicht mehr auf. Haben sie das Hotel verkauft? Ist die Sanktionsgefahr also gebannt?
Geschäftsführer David Frei verweist auf die Informationen im Handelsregister. Mehr könne er dazu nicht sagen. Doch auch das Bündner Firmenregister ist keine grosse Hilfe: Da werden bei der Betreiberfirma des Hotels lediglich Verwaltungsräte aus der Schweiz und Österreich genannt sowie eine einzige Gesellschafterin: eine Firma auf Zypern.
Die Auskünfte im zypriotischen Handelsregister sind zwar umfassender als jene in der Schweiz. Aber auch sie führen nicht zu den wirklichen Besitzern des Grace La Margna. Die zypriotische Firma gehört einer anderen zypriotischen Firma und diese wiederum einer Firma auf den britischen Jungferninseln. Dort sind die Dokumente nicht mehr einsehbar. Im Offshore-Paradies verlieren sich die Spuren. Wer auch immer der wahre Besitzer des Grace La Margna in St. Moritz ist – offenbar will er auf keinen Fall entdeckt werden.
Lukoil-Manager mit Offshore-Firmen
Ein Name zieht sich jedoch wie ein roter Faden durch die verschlungene Firmenkonstruktion. Als Direktor der zypriotischen Firmen ist der irische Staatsbürger Philip G. eingetragen. Und nicht nur dort: Im Datenleck Pandora Papers taucht G.s Name als Verwalter mehrerer Offshore-Firmen auf den Jungferninseln auf.
Eigentümer dieser Firmen waren immer Russinnen und Russen aus dem Management von Lukoil. Auch Vizepräsident Alexander Matysyn gehörte zumindest bis 2015 eine von G. verwaltete Firma auf den Jungferninseln. Als diese liquidiert wurde, deklarierte sie ein Vermögen von 890 Millionen Dollar. Der Kauf von ein oder zwei Hotels in St. Moritz wäre für Matysyn also durchaus erschwinglich. Weder Matytsyn noch Zhdanov noch Philip G. waren für Tamedia erreichbar. Die Medienstelle von Lukoil reagierte auf die Anfrage nicht.
Weiss die Gemeindeverwaltung von St. Moritz über die wahren Besitzer von so markanten Hotelbauten wie dem La Margna Bescheid? Gemeinderatspräsidentin Claudia Aerni antwortet, dass sie dazu aufgrund der Schweigepflicht nichts sagen könne. Gemeindepräsident Christian Jott Jenny ist als Chef des Steueramts nur froh, «wenn die Steuern und Gebühren der Abwasserleitungen und deren Inhalt beglichen werden». Privates Eigentum könne die Gemeinde nicht kommentieren, so Jenny. Auch das Grundbuchamt in St. Moritz kennt nur die Eigentümerfirma, die im Handelsregister steht.
Dass jedoch selbst verschlungene Firmenkonstruktionen nicht immer vor Enttarnung der Eigentümer schützen, bewies ein texanisches Gericht Ende August: Es genehmigte die Beschlagnahmung einer 45-Millionen-teuren Boeing 737, die Lukoil gehöre. Getarnt wurde der Besitz durch Zwischenfirmen in Österreich, den Niederlanden und auf Zypern.
Zwar ist der Gerichtsentscheid nur symbolisch: Der Lukoil-Jet steht in Russland. Aber er sendet ein Zeichen gegen die Verschleierung von Besitz «durch eine Serie von Holdinggesellschaften», so die US-Behörden. Aufgedeckt wurde der wahre Eigentümer des Jets durch das Team von «KleptoCapture», einer vom US-Justizministerium eingesetzten Taskforce zum Aufspüren russischen Eigentums. Ob die Schweiz eine ähnliche Taskforce bekommt, soll nun der Nationalrat in Bern entscheiden.